Anne Frank

Die tragische Geschichte von Anne Frank berührt viele Menschen. Wir haben ihr kurzes aber sehr einprägsames Leben beleuchtet.
Herkunft und Kindheit
Anne Frank heißt eigentlich Annelies Marie Frank. Sie wurde am 12. Juni 1929 als zweites Kind von Otto Frank und Edith Frank-Holländer in Frankfurt geboren. Die Familie Frank waren Juden, wobei die Mutter gläubiger war als der Vater, der eine große Privatbibliothek besaß und sich um die Bildung seiner Töchter Anne und Margot kümmerte. Anne Frank galt im Gegensatz zu ihrer Schwester als eher lebhaft und extrovertiert. Als die Nationalsozialisten am 13. März 1933 bei der Kommunalwahl in Frankfurt die Mehrheit hatten, kam es in Folge am 1. April zum Judenboykott. Otto Frank sah große Probleme auf seine Familie zukommen.
Exil in den Niederlanden
Die Familie übersiedelte Schritt für Schritt nach Amsterdam, wo sie sich vor der Verfolgung der Nazis sicher fühlten. Während Margot vor allem Interesse an Mathematik zeigte, war Anne Frank schon früh am Lesen und Schreiben interessiert. Ihre Jugendfreundin Hannah Goslar erzählte als Überlebende des Holocaust und wichtige Zeitzeugin, dass Anne häufig heimlich schrieb und nichts über den Inhalt verraten wollte. Im Laufe der nächsten Jahre und im Zuge der Expansion der Nazis sah die Familie Frank, dass sie auch in den Niederlanden nicht sicher waren. Es folgten immer strengere Judengesetze. Die Eltern versucht, den Alltag aufrecht zu erhalten, mussten ihre Töchter aber nun mit der Wahrheit konfrontieren. Zum 13. Geburtstag am 12. Juni 1942 erhielt Anne Frank von ihren Vater ein rot-weißes Poesiealbum. Sie nannte es Kitty und begann noch am selben Tag in niederländischer Sprache darin zu schreiben. Es wurde ihr berühmtes Tagebuch.
Das Versteck
Otto Frank hatte in einem Hinterhaus ein Versteck vorbereitet. Die Türe war mit einem Bücherregal getarnt. Die Lage spitzte sich schnell zu, wodurch die Familie bereits früher als geplant untertauchen musste. Dort versteckten sich diese acht Menschen: Otto Frank, Edith Frank-Holländer, Margot Betti Frank, Anne Frank, Hermann van Pels, Auguste van Pels, Peter van Pels und Fritz Pfeffer. Sie hofften nach wenigen Wochen oder Monaten wieder raus zu können. Die Situation stellte sich allerdings ganz anders dar. Die Versteckten haben mehr als zwei Jahre im Hinterhaus verbracht. In dieser Zeit mussten sie sich immer leise verhalten und durften keine Aufmerksamkeit erregen. Die beengte Lage sorgte immer wieder für Spannungen. In der Zeit hatten die acht Leute Unterstützung von einigen Helfer, die unter anderem Lebensmittel besorgten. Sie setzten sich einem großen Risiko aus. Ihre Namen waren: Miep Gies, Jan Gies, Victor Kugler, Johannes Kleiman und Elisabeth van Wijk-Voskuijl.
Verrat und Verhaftung
Ob und von wem das Versteck verraten wurde, ist bis heute nicht gesichert bekannt. Im Laufe der Zeit sind einige Menschen verdächtigt worden. Als Hauptverdächtiger galt lange Zeit der Lagerarbeiter Wilhelm van Maaren. Er war zwar kein Antisemit, aber sehr neugierig und ein Dieb. Zudem prahlte er mit Verbindungen zur Gestapo. Er selbst bestritt den Verrat des Verstecks.
Verhaftet wurde die Familie Frank vom Polizist und SS-Oberscharführer Karl Josef Silberbauer. Nach dem Krieg kehrte er nach Wien zurück, wurde im Jahr 1952 angeklagt und freigesprochen. Ab 1954 arbeitete er wieder bei der Wiener Polizei.
Das Ende
Die Versteckten wurden deportiert und in Konzentrationslager gebracht. Dort herrschte ein schrecklicher Alltag, von Kälte bis hin zu hygienischen Problemen wie Krätze, Läuse, Typhus und anderen Krankheiten. Anne Frank entging bei ihrer Ankunft zunächst dem sicheren Tod, da sie drei Monate zuvor 15 Jahre alt geworden war. Alle Kinder unter 15 Jahren wurden direkt vergast. Die Häftlinge wurden rasiert und ihnen wurde eine Nummer eintätowiert. Edith Frank-Holländer starb im KZ Auschwitz-Birkenau, Anne Frank und ihre Schwester Margot kamen im KZ Bergen-Belsen ums Leben. Vater Otto Frank überlebte als Einziger der Versteckten den Holocaust.
Tagebuch der Anne Frank
Das Tagebuch der Anne Frank wurde von der Helferin Miep Gies aufbewahrt und somit vor dem Zugriff der Gestapo geschützt. Nach dem Krieg übergab sie es an den Vater Otto Frank übergeben. Er veröffentlichte im Jahr 1947 das Tagebuch seiner Tochter. Sie führte es von 12. Juni 1942 bis 1. August 1944. Das Tagebuch der Anne Frank zählt heute zur Weltliteratur und wurde 2009 von der UNESCO in das Weltdokumentenerbe aufgenommen. Es dient damit als bedeutendes zeitgeschichtliches Dokument und gibt einen besonders persönlichen Einblick in das Leben der jungen Frau während des Nationalsozialismus.
Hat dir unser Beitrag gefallen? Melde dich für unseren Newsletter an, um informiert zu bleiben! Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, kannst du das mit einer Mitgliedschaft tun.
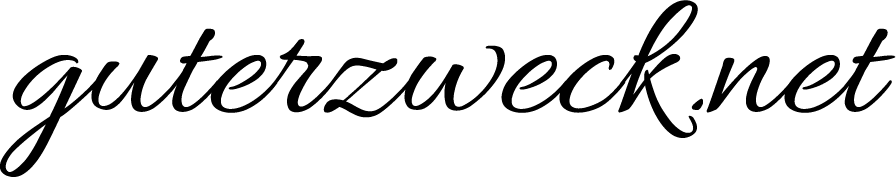


Keine Kommentare