Nachhaltig bauen mit Zement – Mission possible

Wir haben Sebastian Spaun, dem Geschäftsführer der Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie, fünf Fragen zur Zukunft des Bauens mit Zement und Beton gestellt.
Warum brauchen wir Zement auch in Zukunft?
Beton ist der weltweit am meisten verwendete Stoff nach Wasser. Er ist der grundlegende Baustoff für die Gestaltung der modernen Welt. Das liegt an seinen Stärken wie Festigkeit, Tragfähigkeit, Langlebigkeit, Widerstandsfähigkeit, Sicherheit und Erschwinglichkeit, die den Bau wichtiger Infrastruktur ermöglichen – Straßen und Eisenbahnen, Brücken und Tunnels, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, Büros, Gebäude und die Städte, in denen wir leben.
Zement und Beton werden in der breiten Wahrnehmung oft miteinander verwechselt. Beton ist das Material, mit dem die Menschen täglich zu tun haben. Zement ist der wichtige Klebstoff, der die Bestandteile des Betons miteinander verbindet und Beton zu dem vielseitigen Baumaterial macht, das auch in Zukunft für Herausforderungen wie die Energie- und Mobilitätswende dringend gebraucht wird.
Wie entsteht CO2 bei der Herstellung von Zement?
Zementklinker wird aus natürlichen mineralischen Rohstoffen – Kalkstein, Ton und Mergel – bei einer Temperatur von 1.450 Grad Celsius gebrannt. Etwa ein Drittel der CO2-Emissionen stammt von den Brennstoffen, zwei Drittel der CO2-Emissionen kommen durch den Prozess der Entsäuerung direkt aus dem Kalkstein, indem Kalziumoxid (CaO) aus Kalziumkarbonat (CaCO3) entsteht. In keinem anderen Land der Erde hat die Zementindustrie den Anteil fossiler Brennstoffe so stark zurückgefahren und durch Alternativen ersetzt wie in Österreich. Auch der hohe Anteil von Zumahlstoffen beim Mahlen von Zement trägt zum geringen Fußabdruck heimischer Zemente im internationalen Vergleich bei. Diese Stoffe ersetzen die CO2-intensive Komponente Zementklinker.
Wie kann die Zementindustrie die Klimaziele erreichen?
Die österreichische Zementindustrie hat in den Jahren von 2020 bis 2022 ihre Roadmap erarbeitet, in der sie aufzeigt, wie CO2-Neutralität bei der Zementherstellung bis zum Jahr 2050 erreicht werden kann. Dazu ist ein Bündel an Maßnahmen erforderlich, wie die weitere Optimierung der Produktionsverfahren, tiefgreifende Änderungen im Produktportfolio durch die Entwicklung neuer, CO2-reduzierter Zemente sowie der Einsatz innovativer Technologien. Denn zwei Drittel der CO2-Emissionen stammen direkt aus dem Kalkstein, ein Teil dieser Emissionen wird von Beton über den Lebenszyklus durch den Prozess der Carbonatisierung wieder aufgenommen.
Auch andere Technologien zur CO2-Abscheidung werden für die CO2-neutrale Zementherstellung erforderlich sein. Mit den besonderen Eigenschaften der Drehrohröfen hat die Zementindustrie zudem großes Potenzial, eine Vielfalt von Reststoffen stofflich und thermisch zu verwerten. Das spart CO2 und macht die Zementindustrie zu einem wichtigen Partner in der Kreislaufwirtschaft. In ihrer Roadmap hat die österreichische Zementindustrie die Potenziale zur CO2-Reduktion in den Bereichen Klinkerherstellung, Zement und Beton, Strom und Transport, Carbonatisierung sowie CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage bzw. CO2-Abscheidung, -Nutzung und Speicherung) verortet.

Warum braucht es neue Zemente?
Der CO2-Fußabdruck von Zementen hängt überwiegend vom Klinkeranteil in der jeweiligen Zementsorte ab. Dieser wird durch den Einsatz diverser Zumahlstoffe im Zement reduziert. Die Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie und ihre Mitglieder haben gemeinsam mit der Smart Minerals GmbH die CEM-II/C-Zemente entwickelt, rund zwei Jahre lang wurde daran geforscht und bautechnische Zulassungen dafür erwirkt. Im Zentrum standen dabei die industrielle Herstellung, insbesondere die Mahlbarkeit, sowie die praktische Anwendbarkeit von Zementen mit deutlich geringeren Klinkergehalten. Die neuen klinkerarmen Zemente sind nunmehr österreichweit am Markt erhältlich und können im Hochbau breit eingesetzt werden. Übrigens, die Anwendung dieser CO2-reduzierten Zementsorte wurde beim Bau der Volksschule in Adnet als richtungsweisendes Pilotprojekt mit dem ACR-Innovationspreis 2024 ausgezeichnet.
Warum werden wir auch in Zukunft mit Beton bauen?
Aufgrund der Langlebigkeit des Materials, der Widerstandsfähigkeit und auch der Regionalität, um nur einige Argumente zu nennen, denn vom Werk bis zur Baustelle fährt Frischbeton in der Regel nur rund 18 Kilometer. Auch in anderen Bereichen geht nichts ohne den Baustoff: Angefangen beim Hochwasserschutz, Tunnelbau bis hin zum Kühlen und Heizen von Gebäuden mit Bauteilaktivierung. Die hellen Oberflächen und die Robustheit machen den Baustoff auch beliebt in der Stadt- und Freiraumplanung. So wurde erst vor kurzem der neue Wiener Naschpark am früheren Naschmarktparkplatz eröffnet, gestaltet mit Wegen aus Betonsteinen. Die helle Pflasterung verhindert starkes Aufheizen zwischen den Grünflächen und durch das Schwammstadtprinzip wird lokal Regenwasser gespeichert und wiederverwendet. Beton macht vieles möglich.

Lieber Herr Spaun, danke für das Interview und die spannenden Einblicke, wie nachhaltig bauen in Zukunft aussehen kann!
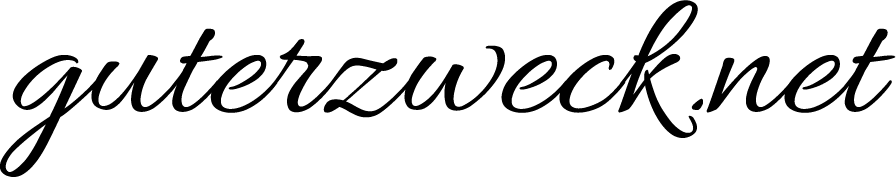


Keine Kommentare